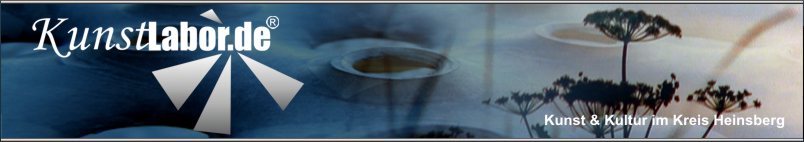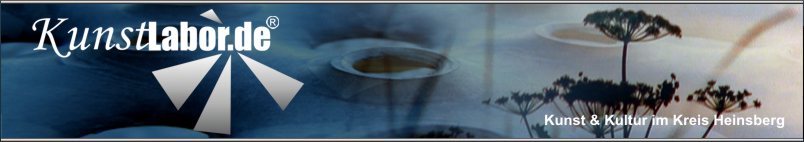|

Wir freuen uns, hier den ersten veröffentlichten Roman des Heinsberger
Schriftstellers Willi van Hengel vorstellen zu dürfen.
Erschienen ist er unter dem Titel "Lucile" im "EDITION LITHAUS" - Verlag.
Rezensionen:
„Ein schönes Spiel mit dem Ich“
Willi van Hengel: Lucile
(edition lithaus, Berlin, 11,90 Euro)
Im Mittelpunkt dieses neu erschienenen Briefromans steht eine
Philosophiestudentin, deren Briefe an ihre Freundin Lucile von zunehmenden
Zweifeln an dem, was wir unter „Realität“ verstehen, bestimmt werden. Nachdem
ihr Freund zu einer Reise aufgebrochen ist, führt sie das Alleinsein in immer
tiefere Fragen: über die Liebe und ihr Leiden verursachendes Wesen, über das
Leben und sein prinzipielles Offensein und über die Sehnsucht nicht nur nach
Menschen, sondern vor allem auch nach Antworten.
Die zunehmenden Zweifel treiben die Protagonistin immer mehr in die Einsamkeit.
Der Austausch mit Freuden findet für sie nur noch an der Oberfläche statt, denn
alles könnte auch anders sein. „Über alles lässt sich streiten, über alles lässt
sich lachen: also über nichts!“ Das Erleben von Kontingenz ergreift auch ihr
eigenes Ich. Sie fühlt sich von anderen nicht mehr gekannt, denn gekannt zu
werden bedeutet, von der eigenen Existenz überzeugt zu sein, und diese
Selbstgewissheit hat die Protagonistin verloren.
Schließlich erscheint auch die scheinbar Halt gebende Brieffreundin Lucile als
imaginär: „obwohl ich gar nicht weiß, ob es dich wirklich gibt, dort in Paris
oder irgendwo anders, außer als ein Wort.“
Nachdem auch die Existenz des Freundes, nach dem sie sich sehnt, in Frage
gestellt wird, bleibt zum Schluss zwingend, die eigene Existenz anzuzweifeln:
„und zuguterletzt ich selbst, die ich mir nicht einmal mehr sicher bin, ob es
mich überhaupt gibt? Ist es nur ein Vorurteil, dass ich lebe, mehr nicht ...?“
Durch die konsequente Einhaltung der Dekonstruktion des Seins fragt sich der
Leser am Ende des Romans, ob um elf Uhr abends wirklich eine junge Frau auf dem
Bahnhof stehen und erleichtert ihren Freund in die Arme schließen wird. Wir
möchten glauben, dass es so ist, um uns selbst zu erleichtern von der gelungenen
Verunsicherung dessen, was wir als existent brauchen, um uns sicher genug zu
sein, das Abendbrot zu machen und am nächsten Tag wieder zur Arbeit zu fahren.
Der Autor Willi van Hengel hat einen bravourösen Debütroman vorgelegt, der sich
durch eine konsequente Fortführung „eines schönen Spiels mit dem Ich“
auszeichnet. Die Gedanken der Protagonistin sind sensibel beschrieben und halten
den Leser bis zum Ende in Bann. Wer hinter die Fassade (s)eines scheinbar
sicheren Ichs blicken möchte, dem sei dieser Roman empfohlen: Verunsicherung ist
garantiert!
„Ein schönes Spiel mit dem Ich“
Willi van Hengel: Lucile
(edition lithaus, Berlin, 11,90 Euro)
Man sucht vergeblich nach den typisch autobiographischen Elementen und mit
keiner Zeile merkt man es ihm, dem 1963 geborenen Autor Willi van Hengel, an,
dass es sein Debütroman ist, genauer gesagt: ein Roman in Briefen.
Und es sind viele Briefe, die geschrieben werden – einer lesbarer und Neugierde
weckender als der andere. Gleichwohl werden sie allesamt von nur einer einzigen
Person verfasst: einer Frau, die namenlos bleibt. Sie studiert Philosophie in
Bonn und schreibt – entweder aus dem Garten ihrer Mutter im Heimatdorf oder aber
aus Bonn – ihrer besten Freundin Lucile, die in Paris lebt und Bildhauerin ist.
Der Autor Willi van Hengel nimmt also ein großes Wagnis auf sich: Er schreibt
aus der Sicht einer Frau. Wahrlich, es ist ihm gelungen. Denn man muss schon
sehr aufmerksam lesen, um der Briefeschreiberin ein männliches Denken oder
Verhalten vorhalten zu können. Thema der Briefe ist in erster Linie die
Sehnsucht der Verfasserin, die auf ihren geliebten Freund André wartet; er ist
als Assistent seines Professors für zehn Tage auf einem Physikerkongress in
Dubrovnik.
Das Alleinsein führt sie in immer tiefere Fragen: über die Liebe und ihr Leiden
verursachendes Wesen, über das Leben und sein prinzipielles Offensein und über
die Sehnsucht nicht nur nach Menschen, sondern vor allem auch nach Antworten.
Willi van Hengel, der einst selbst Philosophie studiert hat, lässt die
Briefeschreiberin immer weniger Atem. Doch – und das ist das Überraschende an
diesem Roman – genau das Gegenteil empfindet der Leser, der nicht mehr aufhören
will zu lesen und das Buch nicht mehr aus der Hand legen will.
Nichts in diesem Roman ist gezeichnet von schlechten Stimmungen oder pressiven
Gemütslagen, auch nicht von philosophischen Sentenzen oder klugen
Allerweltssprüchen. Im Gegenteil. Keine (Denk-)Pose wirkt gekünstelt; selbst die
manierierte Sprechblase eines angenehmen Jünglings, der der Verfasserin in einer
Buchhandlung die Hände auf den Busen legen möchte, und es, mit ihrem wortlosen
Einverständnis, auch wirklich tut, kommt nicht störend daher.
Um es klar zu sagen: Mir - als ein Leser unter hoffentlich vielen – ist es zu
wenig an philosophischer Auseinandersetzung. Es könnte mehr sein. Zumal der
Roman auf einem solchen Hintergrund gedeiht: „Vielleicht ist es nur ein
Vorurtheil, dass ich lebe“, fragt Nietzsche – und genau diese Frage tellt der
Roman im Ganzen dar.
Man hat zwar den Eindruck, dass die Schreiberin zusehends verwirrter wird und
sich von der Realität immer weiter entfernt. Doch in Wirklichkeit spielt sie
diese Frage bis ins Letzte durch. Jeder Moment des Lebens birgt auch sein
Gegenteil. Es erinnert an eine gelungene Dekonstruktion ganz im Sinne des
französischen Philosophen Jacques Derrida: eine Lösung ist nicht in Sicht.
Folglich endet der Roman auch in der offenen Frage, ob sie, die Verfasserin der
Briefe, überhaupt auf dem Weg zum Bahnhof ist, wo sie ihren über alles geliebten
André aus Dubrovnik (zurück) erwartet. Oder trifft er gar nicht ein, weil sie
auch ihn, wie es an einer Stelle heißt, „erfunden“ hat.
Ich als Leser fühlte mich aufs Angenehmste gefangen im Leben dieses Buches. Und
wusste nicht genau, wo meine Realität war, wo ich bleiben wollte. „Nur Leidende
hängen an der Liebe, wie die Wirklichkeit an ihnen“, liest man in einem Brief,
der auf dem „Flug“ nach Paris unterwegs ist. Der Flug hätte für mich niemals
enden sollen...
"Die Brücke" Saarbrücken (hg. von Necati Mert)
Text: Vom Künstler geliefert
|